Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 658, S. 476
Current repository:
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 658, S. 476
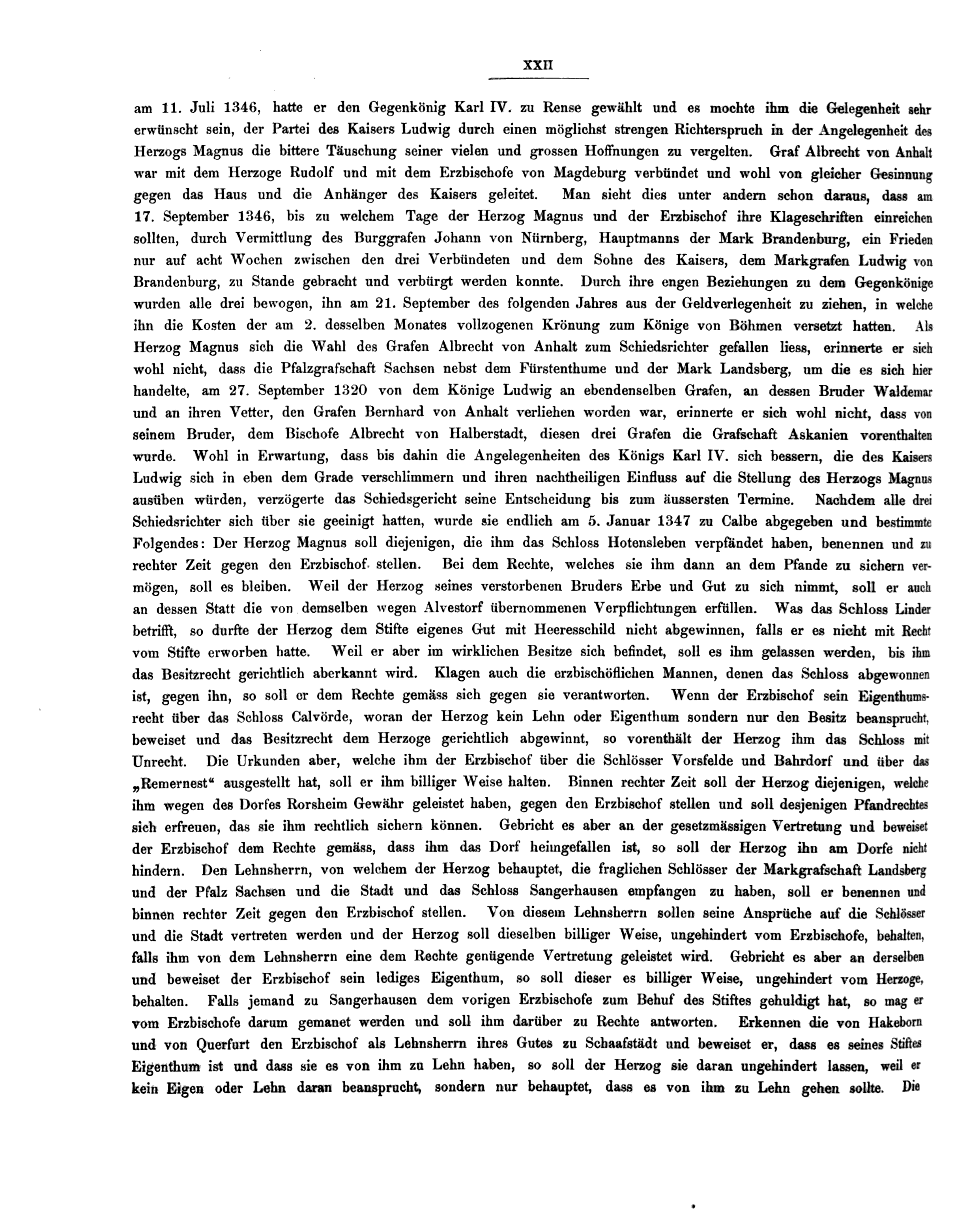
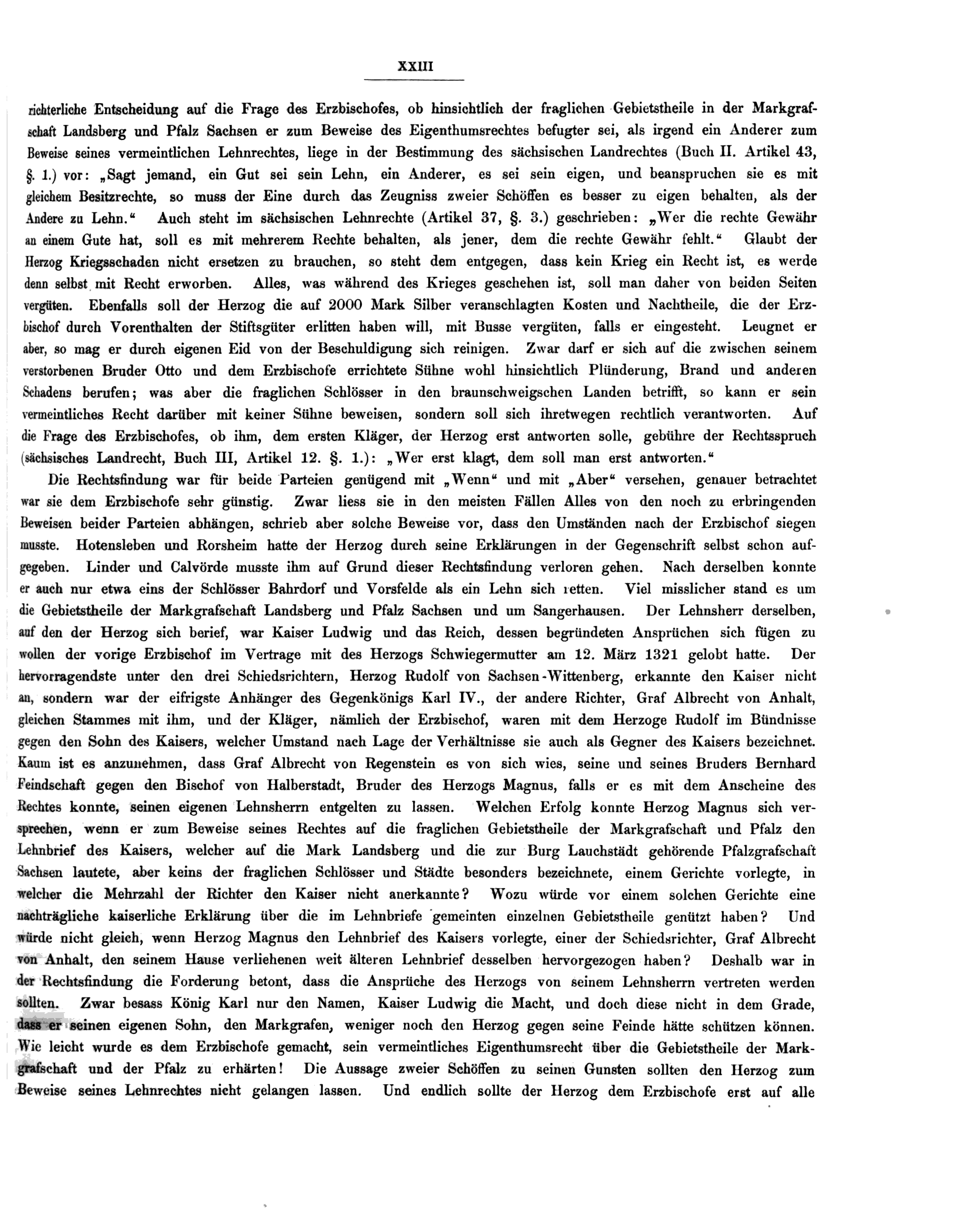
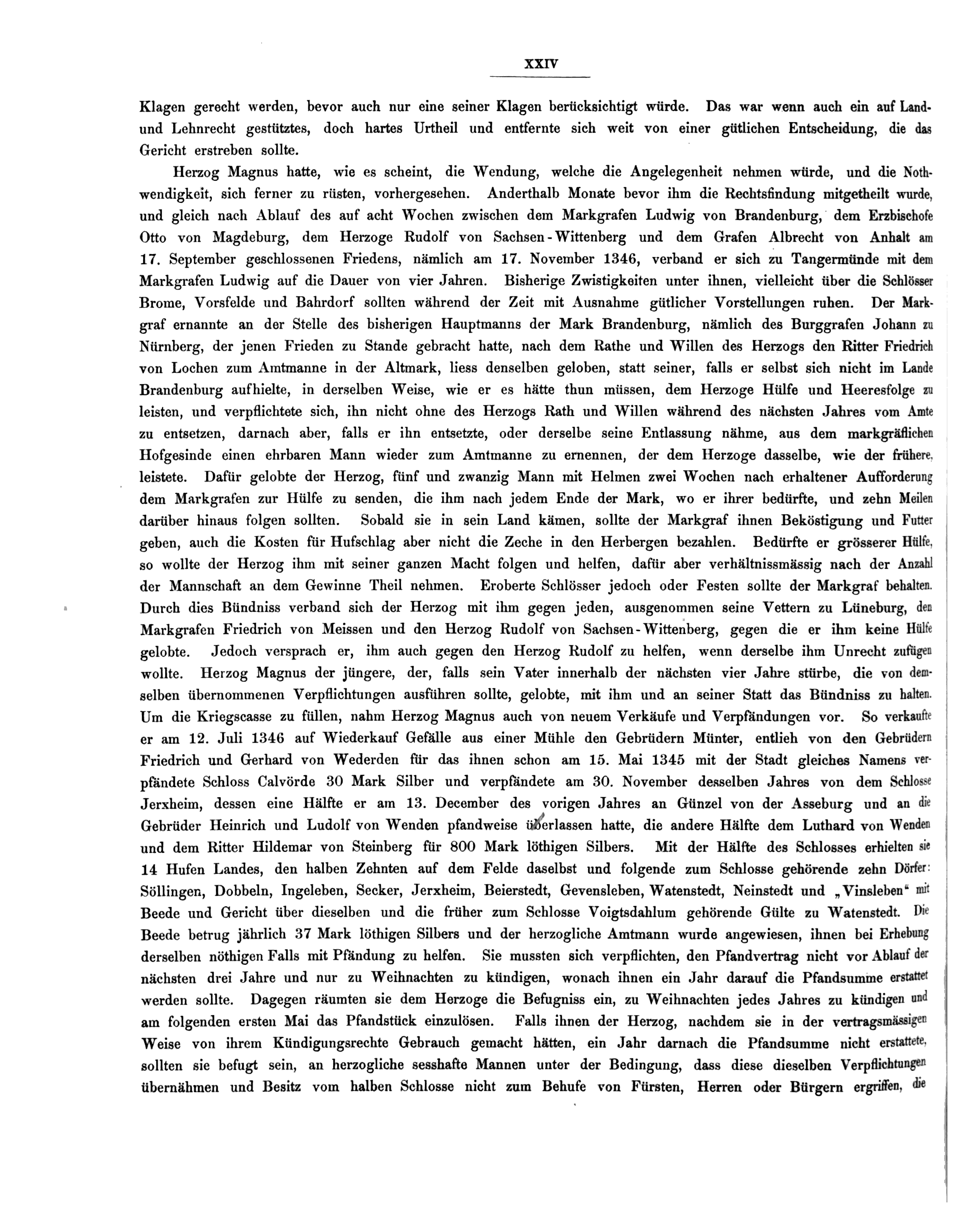
Current repository:
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande bis zum Jahre 1341, Nr. 658, S. 476
XXIII
richterliche Entscheidung auf die Frage des Erzbischofes, ob hinsichtlich der fraglichen Gebietstheile in der Markgraf schaft Landsberg und Pfalz Sachsen er zum Beweise des Eigentumsrechtes befugter sei, als irgend ein Anderer zum Beweise seines vermeintlichen Lehnrechtes, liege in der Bestimmung des sächsischen Landrechtes (Buch II. Artikel 43, §. 1.) vor: „Sagt jemand, ein Gut sei sein Lehn, ein Anderer, es sei sein eigen, und beanspruchen sie es mit gleichem Besitzrechte, so muss der Eine durch das Zeugniss zweier Schöffen es besser zu eigen behalten, als der Andere zu Lehn." Auch steht im sächsischen Lehnrechte (Artikel 37, §. 3.) geschrieben: „Wer die rechte Gewiihr an einem Gute hat, soll es mit mehrerem Rechte behalten, als jener, dem die rechte Gewähr fehlt." Glaubt der Herzog Kriegeschaden nicht ersetzen zu brauchen, so steht dem entgegen, dass kein Krieg ein Recht ist, es werde denn selbst mit Recht erworben. Alles, was während des Krieges geschehen ist, soll man daher von beiden Seiten vergüten. Ebenfalls soll der Herzog die auf 2000 Mark Silber veranschlagten Kosten und Nachtheile, die der Erz- bischof durch Vorenthalten der Stiftsgüter erlitten haben will, mit Busse vergüten, falls er eingesteht. Leugnet er aber, so mag er durch eigenen Eid von der Beschuldigung sich reinigen. Zwar darf er sich auf die zwischen seinem verstorbenen Bruder Otto und dem Erzbischofe errichtete Sühne wohl hinsichtlich Plünderung, Brand und anderen Schadens berufen; was aber die fraglichen Schlösser in den braunschweigschen Landen betrifft, so kann er sein vermeintliches Recht darüber mit keiner Sühne beweisen, sondern soll sich ihretwegen rechtlich verantworten. Auf die Frage des Erzbischofes, ob ¡hm, dem ersten Kläger, der Herzog erst antworten solle, gebühre der Rechtsspruch (sächsisches Landrecht, Buch HI, Artikel 12. §. 1.): „Wer erst klagt, dem soll man erst antworten."
Die Rechtsfindung war für beide Parteien genügend mit „Wenn" und mit „Aber" versehen, genauer betrachtet war sie dem Erzbischofe sehr günstig. Zwar liess sie in den meisten Fällen Alles von den noch zu erbringenden Beweisen beider Parteien abhängen, schrieb aber solche Beweise vor, dass den Umständen nach der Erzbischof siegen musste. Hotensleben und Rorsheim hatte der Herzog durch seine Erklärungen in der Gegenschrift selbst schon auf gegeben. Linder und Calvörde musste ihm auf Grund dieser Rechtsfindung verloren gehen. Nach derselben konnte er auch nur etwa eins der Schlösser Bahrdorf und Vorsfelde als ein Lehn sich retten. Viel misslicher stand es um die Gebietstheile der Markgrafschaft Landsberg und Pfalz Sachsen und um Sangerhausen. Der Lehnsherr derselben, aof den der Herzog sich berief, war Kaiser Ludwig und das Reich, dessen begründeten Ansprüchen sich fügen zu wollen der vorige Erzbischof im Vertrage mit des Herzogs Schwiegermutter am 12. März 1321 gelobt hatte. Der hervorragendste unter den drei Schiedsrichtern, Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg, erkannte den Kaiser nicht an, sondern war der eifrigste Anhänger des Gegenkönigs Karl IV., der andere Richter, Graf Albrecht von Anhalt, gleichen Stammes mit ihm, und der Kläger, nämlich der Erzbischof, waren mit dem Herzoge Rudolf im Bündnisse gegen den Sohn des Kaisers, welcher Umstand nach Lage der Verhältnisse sie auch als Gegner des Kaisers bezeichnet. Kaum ist es anzunehmen, dass Graf Albrecht von Regenstein es von sich wies, seine und seines Bruders Bernhard Feindschaft gegen den Bischof von Halberstadt, Bruder des Herzogs Magnus, falls er es mit dem Anscheine des Rechtes konnte, seinen eigenen Lehnsherrn entgelten zu lassen. Welchen Erfolg konnte Herzog Magnus sich ver sprechen, wenn er zum Beweise seines Rechtes auf die fraglichen Gebietstheile der Markgrafschaft und Pfalz den Lehnbrief des Kaisers, welcher auf die Mark Landsberg und die zur Burg Lauchstädt gehörende Pfalzgrafschaft Sachsen lautete, aber keins der fraglichen Schlösser und Städte besonders bezeichnete, einem Gerichte vorlegte, in welcher die Mehrzahl der Richter den Kaiser nicht anerkannte? Wozu würde vor einem solchen Gerichte eine nachträgliche kaiserliche Erklärung über die im Lehnbriefe gemeinten einzelnen Gebietstheile genützt haben? Und würde nicht gleich, wenn Herzog Magnus den Lehnbrief des Kaisers vorlegte, einer der Schiedsrichter, Graf Albrecht von Anhalt, den seinem Hause verliehenen weit älteren Lehnbrief desselben hervorgezogen haben? Deshalb war in der Rechtsfindung die Forderung betont, dass die Ansprüche des Herzogs von seinem Lehnsherrn vertreten werden sollten. Zwar besass König Karl nur den Namen, Kaiser Ludwig die Macht, und doch diese nicht in dem Grade, dass er seinen eigenen Sohn, den Markgrafen, weniger noch den Herzog gegen seine Feinde hätte schützen können. Wie leicht wurde es dem Erzbischofe gemacht, sein vermeintliches Eigenthumsrecht über die Gebietstheile der Mark grafschaft und der Pfalz zu erhärten! Die Aussage zweier Schöffen zu seinen Gunsten sollten den Herzog zum Beweise seines Lehnrechtes nicht gelangen lassen. Und endlich sollte der Herzog dem Erzbischofe erst auf alle
xxrv
Klagen gerecht werden, bevor auch nur eine seiner Klagen berücksichtigt würde. Das war wenn auch ein auf Land- und Lehnrecht gestütztes, doch hartes Urtheil und entfernte sich weit von einer gütlichen Entscheidung, die das Gericht erstreben sollte.
Urkundenbuch Braunschweig und Lüneburg, ed. Sudendorf, 1859 (Google data) 658, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/BraunschweigLueneburg/c4d32e89-6744-4ed0-b9df-4c2fdf544bd2/charter>, accessed 2025-08-18+02:00
The Charter already exists in the choosen Collection
Please wait copying Charter, dialog will close at success